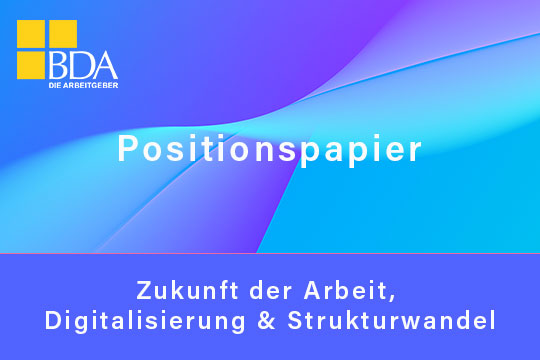Mehr Tempo mit einem Digitalministerium
Positionspapier zu Eckpunkten eines erfolgreichen Digitalministeriums aus Arbeitgebersicht
In Kooperation mit dem BDA-Digitalrat
20. März 2025
Zusammenfassung
Die Digitalisierung und insbesondere der Einsatz von Künstlicher Intelligenz gewinnen immer mehr an Bedeutung. Sie durchdringen alle Lebensbereiche und können – richtig angewandt – ein Schlüssel zu vielen Herausforderungen unserer Zeit sein. Digitale Tools können Unternehmen produktiver und wettbewerbsfähiger, Arbeit leichter und kreativer und die Verwaltung effizienter machen. Durch ihre großen Automatisierungspotenziale können sie zur Bekämpfung des Fachkräftemangels beitragen und helfen, Ressourcen gezielter und schonender einzusetzen. Kurzum: Die Vorteile liegen auf der Hand. In der kommenden Bundesregierung sollte die Digitalisierung daher mit wesentlich mehr Nachdruck als bisher vorangetrieben werden. Eine Lösung wäre es, ein Digitalministerium einzurichten.
Alle bisherigen Konstrukte, die Steuerung der Digitalisierung innerhalb der Bundesregierung zu verankern, waren nicht durchschlagend erfolgreich – weder die Ansiedelung des Themas im Kanzleramt (Verantwortung bei einer Staatsministerin oder beim Chef des Bundeskanzleramts) noch die Einsetzung eines CIO Bund im Bundesministerium des Innern brachten den Durchbruch. Der mangelnde Erfolg hing nicht immer an den handelnden Personen, sondern an den fehlerhaften Strukturen, die eine echte Steuerung nicht ermöglichten.
Ein Digitalministerium darf daher kein Selbstzweck oder Budenzauber sein. Es muss mit klar festgelegten Durchgriffsrechten ausgestattet sein, um die Querschnittsthemen der Digitalisierung zu steuern und zu bündeln. Bislang arbeiten Bundesministerien oft unkoordiniert an Projekten. Das verzögert Prozesse und führt zu Ineffizienz und Doppelstrukturen. Darüber hinaus braucht ein Digitalministerium zur erfolgreichen Steuerung der Prozesse eine Budgethoheit über Digitalisierungsprojekte. Durchgriffsrechte werden erst durch eine Budgethoheit ernst. Schließlich bietet der Aufbau eines neuen Digitalministeriums auch die Chance, neue, schnellere und effizientere Arbeitsabläufe in der Verwaltung zu etablieren. Ein darauf fokussiertes Ministerium könnte auch einen neuen Verwaltungs-Mindset und eine digitalisierungsfreundlichere Arbeitskultur entfalten. Eine Digitalministerin bzw. ein Digitalminister sollten nicht nur über politisches Durchsetzungsvermögen verfügen, sondern auch umfassende Fachkenntnisse in den Bereichen Digitalisierung und Transformation mitbringen. Sie müssen die Fähigkeit besitzen, digitale Prozesse zu verstehen, innovative Strategien zu entwickeln und diese mit politischem Geschick und Weitsicht umzusetzen.
Ein Digitalministerium kann dafür sorgen, dass die Digitalisierung auf Bundesebene endlich schneller, effizienter und kundenorientierter vorangeht. Allerdings müssen sich Bund und Länder grundsätzlich über die Kompetenzen in der Digitalisierung und die Ausgestaltung des Föderalismus Gedanken machen. Richtig gemacht, würde ein Digitalministerium mit effizienteren Strukturen in der Öffentlichen Verwaltung dabei helfen, eine Antwort auf den Fachkräftemangel zu geben. Die bisherige Antwort von „mehr Personal“ auf neue Aufgaben in der Öffentlichen Verwaltung würde abgelöst von der Antwort „mehr Digitalisierung und mehr Automatisierung“. Für die operative Umsetzung von Digitalprojekten sollte eine Digitalagentur auf Bundesebene das Digitalministerium unterstützen. Die Agentur muss auch zur engeren Verzahnung mit der Wirtschaft und weiteren Stakeholder genutzt werden.
Zentrale Punkte aus Arbeitgebersicht
- Das Digitalministerium muss über ausreichende Kompetenzen und weitreichende Durchgriffsrechte mit Budgethoheit verfügen, um relevante Digitalprojekte zu koordinieren und Ressourcen effizient zu steuern.
- Das bereits aufgebaute Digitalisierungs-Know-How sollte in den bestehenden Ministerien verbleiben. Die Koordination der Projekte erfolgt jedoch durch das neue Digitalministerium.
- Unterhalb des Digitalministeriums sollte eine Digitalagentur agieren, die die praktischen Digitalisierungsprojekte umsetzt und die Ressorts bei ihren eigenen Vorhaben unterstützt.
- Ein Digitalministerium sollte einen Schwerpunkt seiner Arbeit auf die Verwaltungsdigitalisierung legen, aber auch allgemeiner Treiber bei digitalen Technologien wie Künstliche Intelligenz, Cyber-Securtiy, Cloud-Computing und Quantencomputing sein.
- Um Digitalisierungsprojekte anzuschieben, die noch nicht in anderen Fachressorts angesiedelt sind, braucht das Digitalministerium ein adäquates eigenes Budget.
- Eine Digitalministerin bzw. ein Digitalminister sollten nicht nur über politisches Durchsetzungsvermögen verfügen, sondern auch umfassende Fachkenntnisse in den Bereichen Digitalisierung und Transformation mitbringen.
- Ein Digitalministerium und eine Digitalagentur müssen nicht nur eng mit der Privatwirtschaft zusammenarbeiten, sondern auch spürbar bessere Rahmenbedingungen für Unternehmen schaffen.
- Es bedarf eines neuen Mindsets in der Verwaltung. Ein Digitalministerium kann auch ein Labor für moderne Behördenarbeit sein und sollte Treiber der Digitalisierung werden.
Klare Kompetenzen und umfassende Durchgriffsrechte als Bedingung für den Erfolg eines Digitalministeriums
Über Jahrzehnte aufgebaute staatliche Strukturen – zumal in analogen Zeiten – sind oftmals doppelt, ineffizient und teuer. Fragmentierte Zuständigkeiten und fehlende Durchgriffsrechte einer steuernden Instanz sind wesentliche Ursachen für den aktuellen Stillstand und schaden Deutschland. Eine aktuelle Studie hat ermittelt, dass der Bund von 2019 bis 2024 insgesamt 16 Mrd. € für digitalpolitische Maßnahmen ausgegeben hat – ohne spürbaren Erfolg für Unternehmen und Bürger, da schnelle Verfahren und bürokratische Entlastung ausbleiben.[1]
Deutschland fängt bei der Digitalisierung nicht bei null an. Das Problem ist vielmehr die Komplexität. Ein Digitalministerium könnte die Antwort auf eine zentrale Kernfrage sein: Wie kann das Querschnittsthema Digitalisierung in der Bundesverwaltung horizontal bearbeitet werden, aber in der Vertikalen durch eine zentrale Institution gesteuert werden? Für diese erfolgreiche Arbeit muss ein Digitalministerium mit einem umfassenden Durchgriffsrecht ausgestattet sein.
Ein mögliches Modell für die Bundesebene könnte das Hessische Digitalministerium sein. Dort wurden zwei separate Budgets eingeführt: Eines, das die Digitalprojekte der anderen Ressorts koordiniert, steuert und überwacht, sowie ein weiteres für ministeriumseigene Aufgaben.[2] Das Ministerium entscheidet durch die Freigabe des Digitalbudgets für die einzelnen Ressorts, welche Projekte priorisiert und umgesetzt werden – eine kohärente Digitalpolitik in einem Guss. So lässt sich sicherstellen, dass durch die zentrale Koordination Ressourcen effizienter und gezielter eingesetzt werden. Der Erfolg einer Maßnahme kann durch ein zentrales Monitoring besser bewertet werden, was wiederum konkrete Handlungsimpulse ermöglicht.
Damit dieses Modell erfolgreich umgesetzt wird, ist politischer Wille und die Bereitschaft zur Veränderung erforderlich. Beispielsweise müsste die ressortübergreifende Zusammenarbeit neu strukturiert werden, idealerweise durch eine Anpassung der Geschäftsordnung der Bundesregierung, sodass IT-Projekte und IT-Standards nicht mehr dem Ressortprinzip unterliegen.[3] Auf diese Weise könnte ein Digitalministerium ein wirksames Durchgriffsrecht als Steuerungselement für Inhalte über das Budget etablieren.
Ein Digitalministerium, das vorhandene Strukturen nutzt
Digitalpolitik ist ein Querschnittsthema, das sich auch in fragmentierten Zuständigkeiten widerspiegelt. So findet man in allen Bundesministerien spezialisierte Abteilungen und Referate, die sich mit der Digitalisierung ihrer jeweiligen Fachgebiete befassen. Damit dieses „Know-How“ optimal genutzt werden kann, sollten die Digitalisierungsstellen der Ministerien in den Häusern verbleiben – jedoch unter der Koordination des neuen Digitalministeriums.
Für eine reibungslose Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Ministerien und dem Digitalministerium wären Spiegelreferate im Digitalministerium als Schnittstelle zu den jeweiligen Ministerien und Digitalisierungseinheiten in den Häusern eine denkbare Lösung. Damit wird auf vorhandenen Strukturen aufgebaut und gleichzeitig strukturiertes und innovatives Verwaltungshandeln ermöglicht. Ein Digitalministerium, das auf dem Reißbrett von null an entworfen wird, würde zu viel Zeit, Geld und personelle Ressourcen in Anspruch nehmen. Ob es jenseits der Fachressorts eine inhaltlich bessere Arbeit machen würde, ist fragwürdig. Ziel ist ein kleines, aber schlagfertiges Ministerium.
Ein Beispiel die für mangelnde Abstimmung zwischen Fachressorts war die Entwicklung eines digitalen Bildungsraums in der zurückliegenden Legislatur. Dieses digitale Portal soll bildungsbereichsübergreifend die Möglichkeit bieten, Bildungsnachweise zu verwalten. Obwohl sie inhaltliche Schnittstellen aufwiesen, wurden von zwei verschiedenen Ressorts (Bundesarbeits- und das Bundesbildungsministerium) und unterschiedlichen Teams Portale entwickelt und verantwortet („mein NOW“ und „Mein Bildungsraum“). Das führte nicht nur zu Doppelstrukturen, sondern auch zu Reibungsverlusten. Mit einem Digitalministerium, das die Steuerung für solche Projekte übernehmen würde, könnte eine klare Zuständigkeit definiert werden. Das Projekt würde beispielsweise im Bundesbildungsministerium verbleiben, jedoch vom Digitalministerium über die Budgetierung von Digitalprojekten gesteuert. Damit würde verhindert werden, dass entsprechende Portale unabgestimmt entstehen, obwohl sie teilweise vergleichbare Ziele verfolgen.
Eine funktionierende Digitalagentur als operative Umsetzungseinheit
Unterhalb eines Digitalministeriums sollte eine Digitalagentur eingerichtet werden. Auf diese Weise können die politischen Zielvorgaben von der fachlichen Umsetzungsverantwortung getrennt werden. In der Digitalagentur könnten wesentliche Digitalprojekte verantwortet und die Ressorts bei ihren eigenen Digitalprojekten unterstützt werden. Dabei sollte eine Digitalagentur möglichst unpolitisch agieren und sich vorrangig auf das professionelle Projektmanagement konzentrieren.
Wichtig ist, dass klare Ansprechpartner definiert und Doppelstrukturen vermieden werden. Die Digitalagentur des Bundes sollte vorerst primär die Digitalisierungsaufgaben des Bundes fokussieren.
Zusammenarbeit und Austausch mit der Privatwirtschaft
Die deutsche Wirtschaft benötigt eine schnelle und effiziente Verwaltung, die Unternehmen bei Investitionsvorhaben unterstützt und somit Wachstum ermöglicht. Die öffentliche Verwaltung darf sich nicht zum Bremser von unternehmerischer Dynamik und wirtschaftlicher Initiativen entwickeln. Eine effiziente, digitale öffentliche Verwaltung muss ein Wettbewerbsvorteil für den Wirtschaftsstandort Deutschland darstellen. Aus Arbeitgebersicht muss ein Digitalministerium – ebenso wie eine mögliche Digitalagentur – eng mit der Privatwirtschaft zusammenarbeiten. Ebenso sollte ein Digitalministerium das Angebot an Open Data erweitern und die Nutzung dieser Datenbasis durch Dritte zur Förderung von Innovationen unterstützen. Nur so kann sichergestellt werden, dass die Verzahnung digitaler Schnittstellen zwischen privater Wirtschaft und öffentlicher Verwaltung funktioniert und die gewünschten positiven Effekte wie Entbürokratisierung oder schnellere Verfahren eintreten.
Neues Ministerium, neues Denken und neue Praxis
Ein Digitalministerium zu schaffen, bietet auch die Chance, das Thema disruptiv anzugehen. Die Kernfrage ist, wie ein Digitalministerium erfolgreich organisiert und aufgebaut werden kann. Das Arbeiten in Verwaltungen könnte grundlegend neu gedacht werden. So kann es als Labor für neues Arbeiten fungieren und das Mindset grundlegend ändern. Ohne dieses offenere Denken für die Arbeit in der Verwaltung, eine andere Haltung und mehr Offenheit für Veränderungsprozesse bleibt echter Fortschritt aus.
Ein Digitalministerium und seine Beschäftigten müssen an den Fortschritt glauben, Disruption ermöglichen und neue Verwaltungsstrukturen aktiv vorantreiben. Sie müssen Innovation fördern, Bürokratie abbauen und eine moderne, agile Verwaltung schaffen, die den digitalen Wandel nicht nur verwaltet, sondern aktiv gestaltet.
Ein Digitalministerium sollte dafür sorgen, dass die Digitalisierung auf Bundesebene endlich schneller, effizienter und kundenorientierter vorangeht. Allerdings müssen sich Bund und Länder grundsätzlich über die Kompetenzen in der Digitalisierung und die Ausgestaltung des Föderalismus Gedanken machen. Ein neues Digitalministerium sollte eng mit anderen Stakeholdern wie dem IT-Planungsrat und der FITKO zusammenarbeiten. Auch auf europäischer Ebene kann ein neues Ministerium mit gebündelten Kompetenzen die deutsche Position stärken. Das Ziel muss sein, dass digitale Verwaltungsprozesse für Unternehmen und Bürger auf allen föderalen Ebenen zugänglich sind.
Fußnoten:
[1] vgl. Berechnung des Digitalhaushalts, Wie viel investiert der Bund wirklich in die Digitalisierung? - Agora Digitale Transformation/ ZEW, 2025.
[2] vgl. Für ein echtes Digitalministerium – Vorschläge zur Verbesserung von Deutschlands digitaler Governance, Bitkom, 2025.
[3] vgl. Wie ein Digitalministerium mit Wirkung gelingen kann - Designprinzipien und Umsetzungskonzept, Suder/ Katrin, Muschter/ Sebastian, 2025.
Das vollständige Positionspapier steht Ihnen in der rechten Marginalie zum Download zur Verfügung.
Ansprechpartner:
BDA | DIE ARBEITGEBER
Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände
Abteilung Strategie und Zukunft der Arbeit
T +49 30 2033-1070
strategie@arbeitgeber.de
Die BDA organisiert als Spitzenverband die sozial- und wirtschaftspolitischen Interessen der gesamten deutschen Wirtschaft. Wir bündeln die Interessen von einer Million Betrieben mit rund 30,5 Millionen Beschäftigten. Diese Betriebe sind der BDA durch freiwillige Mitgliedschaft in Arbeitgeberverbänden verbunden.