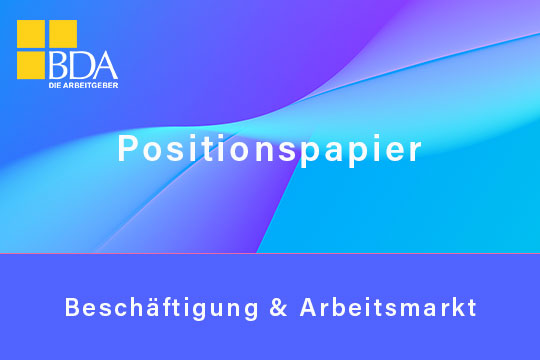Paradoxer Arbeitsmarkt: Warum die steigende Arbeitslosigkeit den Arbeits- und Fachkräftemangel nicht heilt und was zu tun ist
Positionspapier zu den aktuellen Herausforderungen auf dem Arbeitsmarkt
Stand: 28. Juli 2025
Zusammenfassung
Der deutsche Arbeitsmarkt steht vor einer doppelten Herausforderung: einer konjunkturellen Abkühlung und einem massiven demografischen Wandel. Um langfristig Wohlstand und Wettbewerbsfähigkeit zu sichern, braucht es jetzt entschlossene Reformen. Die Arbeitslosenversicherung muss sich auf ihre Kernaufgabe – das Vermitteln in Arbeit und Ausbildung – konzentrieren. Denn genug Chancen gibt es auf dem Arbeitsmarkt. Gleichzeitig müssen konsequent alle Potenziale auf Arbeitsmarkt genutzt werden – etwa durch weniger Frühverrentungsanreize, bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Reformen bei der Arbeitszeit und Zuwanderung in Beschäftigung.
Im Einzelnen
Der deutsche Arbeitsmarkt kühlt sich ab: Seit 2022 steigt die Arbeitslosigkeit und die Drei-Millionen-Marke könnte bald überschritten werden. Gleichzeitig steht Deutschland vor einer massiven demografischen Wende. Bis 2036 gehen 19 Millionen Babyboomer in Rente – ein Viertel aller Beschäftigten. Die konjunkturelle Schwächephase überdeckt die strukturellen Personalengpässe nur oberflächlich. Vielmehr könnte sie dazu beitragen, dass zentrale Reformen nicht umgesetzt und die Engpässe mittelfristig sogar verschärft werden. Denn in Zukunft werden wir alle mehr und nicht weniger arbeiten müssen.
Diese Entwicklung stellt enorme Herausforderungen an Arbeitsmarktpolitik, Weiterbildung und Vermittlung. Es gilt, Arbeitslose und Arbeitgeber trotz sich wandelnder Anforderungen zusammenzubringen und Langzeitarbeitslosigkeit zu vermeiden. Dem Impuls mancher Gewerkschaften, Arbeitslosigkeit mit längerem Arbeitslosengeldanspruch stärker abzufedern und im schlimmsten Fall so dem Arbeitsmarkt Personal zu entziehen, darf nicht nachgegeben werden. Denn es werden dem Arbeitsmarkt ohnehin Millionen Arbeitskräfte fehlen. Zentral sind vor allem folgende Aspekte:
-
- Arbeitgeber brauchen verlässliche Rahmenbedingungen: Damit das Wachstum wieder anspringt, brauchen Arbeitgeber Vertrauen in den Standort und Verlässlichkeit. Auch wenn viele der Unsicherheiten, wie die Zölle und Konflikte, ihren Ursprung im Ausland haben, sind auch viele Probleme hausgemacht. Neben Entlastungen bei Bürokratie, Berichtspflichten, Energiekosten und Unternehmenssteuern sind die Lohnnebenkosten zentral. Die Sozialversicherungsbeiträge müssen dauerhaft bei 40 % liegen, um Arbeit wieder attraktiver zu machen und den Standort zu stärken. Dazu sind Strukturreformen in allen Sozialversicherungszweigen zwingend.
- Alle Potenziale zur Arbeitskräftesicherung nutzen: Deutschland kann es sich nicht leisten, vorhandene Arbeitskraftreserven ungenutzt zu lassen. Wer länger gesund arbeiten kann, soll dazu befähigt und ermutigt werden. Frühverrentungsanreize, wie die sog. abschlagsfreie Rente ab 63, gehören abgeschafft. Stattdessen braucht es flexible Übergänge in den Ruhestand, rechtssichere Weiterbeschäftigungsmöglichkeiten über die Regelaltersgrenze hinaus und ein Reha-System, das präventiv wirkt und effizient organisiert ist. Unternehmen tragen Mitverantwortung: Sie profitieren von erfahrenen Mitarbeitenden und sollten gezielt in deren Erhalt investieren. Gleichzeitig muss die Erwerbsbeteiligung von Frauen deutlich steigen. Das gelingt nur mit einer modernen Familienpolitik: mehr Betreuungsinfrastruktur, flexible Arbeitszeitmodelle und echte Anreize für vollzeitnahe Beschäftigung. Wenn Frauen in gleichem Maße wie Männer erwerbstätig wären, ließen sich hunderttausende zusätzliche Arbeitskräfte mobilisieren. Dafür braucht es ein gesellschaftliches Umdenken – und eine Politik, die gute Rahmenbedingungen schafft, statt Rollenbilder zu zementieren. Wer Wachstum will, muss alle Potenziale heben.
- Mehr Bock auf Arbeit wichtiger denn je: Erwerbstätige in Deutschland arbeiten im Schnitt mit jedem Jahr weniger Stunden. Die inzwischen 46 Mio. Erwerbstätigen arbeiten so viele Stunden wie 40 Mio. Erwerbstätige es 1991 getan haben. Das zahlt nicht auf das Konto der Attraktivität des Standorts Deutschland ein. Wir werden Anreize setzen müssen, damit sich mehr Arbeit lohnt. Zentral sind Änderungen bei Bürgergeld, Wohngeld und Kinderzuschlag. Wer mehr verdient, muss auch netto mehr Geld in der Tasche haben. Die ständig steigenden Lohnzusatzkosten belasten Beschäftigte und Arbeitgeber gleichermaßen.
- Arbeitszeit modernisieren – Flexibilität ermöglichen: Um im internationalen Wettbewerb zu bestehen, braucht Deutschland eine moderne Arbeitszeitkultur. Die hohe Teilzeitquote hat als eine Ursache das restriktive Arbeitsrecht. Die EU-Arbeitszeitrichtlinie bietet Spielräume, die wir nutzen müssen – etwa durch den Wechsel zur wöchentlichen Höchstarbeitszeit. Flexible Arbeitszeiten sind kein Widerspruch zum Arbeitsschutz, sondern Voraussetzung für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Tarifparteien sollten die Freiheit erhalten, branchengerechte Ruhezeiten zu gestalten. Die betriebliche Realität verlangt nach Regelungen, die sowohl den Bedürfnissen der Beschäftigten als auch den Anforderungen der Unternehmen gerecht werden. Neue Aufzeichnungspflichten dürfen die Vertrauensarbeitszeit nicht aushöhlen. Statt starrer Vorgaben braucht es rechtssichere, aber praxisnahe Lösungen – für mehr Flexibilität, mehr Beschäftigung und mehr Wettbewerbsfähigkeit.
- Chancen am Arbeitsmarkt gibt es auf jedem Tätigkeitsniveau: Oft entsteht der Eindruck, ohne Berufsabschluss stehen die Chancen am Arbeitsmarkt schlecht. Das stimmt so pauschal nicht. Im Helferbereich dauert es inzwischen 162 Tage bis eine Stelle besetzt ist – deutlich länger als bei Experten oder Spezialisten. Die Zahl der offenen Stellen im Helferbereich ist deutlich weniger gesunken als bei höheren Qualifikationsniveaus. Diese Chancen am Arbeitsmarkt müssen genutzt werden. In Jobcentern und Arbeitsagenturen muss wieder gelten: Vermitteln, vermitteln, vermitteln.
- Arbeitsvermittlung effizient aufstellen: Die Arbeitslosenversicherung muss mehr auf Kernaufgaben konzentriert werden. Steigende Arbeitslosigkeit und Fachkräftemangel sind eine Herausforderung für die aktive Arbeitsmarktpolitik. Zentral ist, den Ausgleich von Angebot und Nachfrage auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt herzustellen, also Ausbildungs- und Arbeitsuchende und Stellen zusammenzubringen. Ziel jeder Förderung ist es, Arbeitslosigkeit zu verkürzen und Langzeitarbeitslosigkeit zu vermeiden. Dazu gehört eine individuelle Potenzialanalyse ebenso wie eine passgenaue Qualifizierung. Diese ist kein Selbstzweck, sondern muss sich an den tatsächlichen Anforderungen des Arbeitsmarkts und den Fähigkeiten der Person ausrichten.
- Junge Menschen beim Einstieg in den Arbeitsmarkt unterstützen: Für junge Menschen ist die Abkühlung auf dem Arbeitsmarkt eine Herausforderung für den Einstieg in den ersten Job. Unter jungen Menschen ist die Arbeitslosigkeit stärker gestiegen als insgesamt.[1] Die Berufsorientierung muss es schaffen, die ständig veränderten Anforderungen am Arbeitsmarkt im Blick zu halten – und die jungen Menschen darauf vorzubereiten. Die Demografie schlägt besonders bei Ausbildungsberufen zu – umso besser sind also hier die Chancen für junge Menschen. Das muss sich in der Berufsorientierung niederschlagen. Eine frühzeitige, verbindliche berufliche Orientierung, unterstützt durch Kooperationen mit Unternehmen, Arbeitsagenturen und beruflichen Schulen, ist entscheidend.
- Lebenslanges Lernen muss ganz oben auf der Prioritätenliste von Unternehmen und Beschäftigten stehen: Die Hauptverantwortung für die Gestaltung des Strukturwandels liegt bei den Unternehmen und ihren Beschäftigten selbst. Die Unternehmen wissen am besten, welche Weiterbildung nötig ist. Der Staat muss den Rahmen setzen und sollte gezielt fördern – gerade bei Geringqualifizierten. Am besten gelingt Qualifizierung in passgenauen Modulen direkt beim Arbeitgeber – On-the-Job. Berufsabschlüsse lassen sich so oft am besten modular mit Teilqualifikationen im Job nachholen.
- Neue Haltung zur Veränderung: Anpassungsdruck und Wandel erfordern Veränderungsbereitschaft. Den Job wechseln, sich gänzlich neue Fähigkeiten aneignen oder auch mal größere Umzüge – all das ist Teil der neuen Arbeitswelt. Ziel muss sein, dass aus Arbeitslosigkeit keine Langzeitarbeitslosigkeit wird. Auch Arbeitgeber müssen sich an die neue Arbeitswelt anpassen: Unternehmen arbeiten schon heute in Netzwerken zusammen, damit Beschäftigte direkt von einem Unternehmen in ein anderes wechseln können.
- Zuwanderung in Beschäftigung: Deutschland braucht Zuwanderung in Arbeit und Ausbildung. Inländische Potenziale allein werden den Arbeits- und Fachkräftebedarf nicht decken können. Die Bundesregierung muss daher Zuwanderung weiter erleichtern: Das Beschäftigungsverbot in der Zeitarbeit muss abgeschafft, die Westbalkanregelung ausgeweitet und die Migrationsverwaltung umfassend digitalisiert und gezielt zentralisiert werden. Neben den richtigen Rahmenbedingungen ist auch eine offene Willkommenskultur, die von allen gesellschaftlichen Akteuren getragen wird, wichtig. Arbeitskräfte aus dem Ausland brauchen langfristige und attraktive Perspektiven, verfügbaren Wohnraum sowie einen wirksamen Schutz vor Diskriminierung.
Das vollständige Positionspapier steht Ihnen in der rechten Marginalie zum Download zur Verfügung.
Zuständige Fachabteilung:
BDA | DIE ARBEITGEBER
Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände
Abteilung Arbeitsmarkt
T +49 30 2033-1400
arbeitsmarkt@arbeitgeber.de
Die BDA organisiert als Spitzenverband die sozial- und wirtschaftspolitischen Interessen der gesamten deutschen Wirtschaft. Wir bündeln die Interessen von einer Million Betrieben mit rund 30,5 Millionen Beschäftigten. Diese Betriebe sind der BDA durch freiwillige Mitgliedschaft in Arbeitgeberverbänden verbunden.
![]()