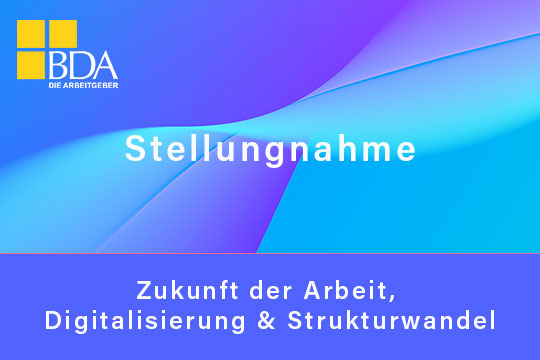Fokus auf Pragmatismus und Innovation: Vom Gesetz bis zur Anwendung
Stellungnahme zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur Durchführung der KI-Verordnung
10. Oktober 2025
Zusammenfassung
Der Referentenentwurf weist in seinen Grundzügen den richtigen Weg: Deutschland braucht eine innovationsfreundliche Umsetzung der KI-VO, effiziente Behördenstrukturen und pragmatische Lösungen auf betrieblicher Ebene. Das ist der richtige Ansatz und muss auch bei der Anwendung weiter gelten, nur so kann Deutschland im globalen Wettbewerb bestehen.
Für die Arbeitgeber in Deutschland ist wichtig, dass sie Klarheit darüber haben, wie sie KI im Betrieb einsetzen können und wer Ansprechpartner in Belangen der KI-VO ist. Dafür ist die grundsätzliche Federführung bei der Bundesnetzagentur sinnvoll. Wichtig ist zudem, dass insbesondere KMU eine unbürokratische und schnelle Beratung bekommen, wenn sie KI-Projekte im Unternehmen angehen und vorantreiben wollen. Mit Blick auf mögliche Sanktionen hält der Referentenentwurf in Teilen Maß. Dies gilt insbesondere für die notwendigen und arbeitsplatzrelevanten KI-Kompetenzen von Beschäftigten. Die Anforderungen bleiben pragmatisch und flexibel geregelt.
Im Einzelnen
Bundesnetzagentur muss Kompetenzen bündeln und Innovation in den Fokus nehmen
Für Arbeitgeber, die in der Regel sog. Betreiber von KI-Systemen sind, muss klar sein, welche Marktaufsichtsbehörde für sie zuständig ist. Gerade KMU müssen wissen, wer ihr Ansprechpartner ist, wenn sie z. B. unsicher sind beim Einsatz von Hochrisiko-KI. Dafür ist es hilfreich, dass die Bundesnetzagentur (BNetzA) als zentrale Aufsichtsbehörde dienen soll.
Sektorale Behörden, wie die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, die bereits für bestimmte Produkte zuständig sind, behalten ihre Zuständigkeit, wenn das Produkt nun auch KI enthält. Das ist sinnvoll, denn es erleichtert insbesondere die Kommunikation mit den Entscheidungsträgern in den Unternehmen und verhindert Doppelzuständigkeiten und Rechtsunsicherheiten. Wichtig ist aber, dass die BNetzA, auch wenn sie im Einzelfall nicht zuständig ist, Anliegen der Unternehmen über kurze, unkomplizierte Wege an die richtige Stelle weiterleitet. Es darf keine Zuständigkeitsschieberei zu Lasten der Betriebe geben.
Vor dem Hintergrund, dass damit mehrere Aufsichtsbehörden dasselbe Recht auslegen müssen – wenn auch für verschiedene Sachverhalte – kommt dem geplanten Koordinierungs- und Kompetenzzentrum bei der BNetzA eine hohe Bedeutung zu. Die BNetzA muss diese Aufgabe ernst nehmen und konsequent auf eine einheitliche, innovationsfreundliche Auslegung der KI-VO hinwirken. Ein Flickenteppich an unterschiedlicher Auslegungspraxis würde Unternehmen verunsichern und sie daran hindern, das angesichts der konjunkturellen Lage dringend notwendige Produktivitätspotenzial von KI auszuschöpfen.
Die KI-VO schreibt zu Recht innovationsfördernde Maßnahmen vor, wie die Einrichtung eines KI-Reallabors, in dem KI-Systeme sicher entwickelt und erprobt werden können. Das erste KIReallabor muss bis zum 2. August 2026 betriebsbereit sein. Es ist gut, dass jetzt endlich die Zuständigkeit der BNetzA dafür festgesetzt wird. Besonders sinnvoll ist, dass neben diesen durch die KI-VO vorgeschriebenen Maßnahmen ein KI-Service Desk bei der BNetzA, eingerichtet werden soll, der auch Betreiber unterstützen soll. Dieser Service-Desk muss neben allgemeinen Informationen und Anleitungen unbürokratische, schnelle Beratung, insbesondere für KMU und Start-Ups anbieten. Gerade sie brauchen Unterstützung und schnelle Rechtssicherheit beim Einsatz von KI-Tools, weil sie häufig nicht die Ressourcen – finanziell, personell oder zeitlich – haben, auf die Konzerne zurückgreifen können.
Wichtig ist, dass die BNetzA schon jetzt ins Handeln kommt und noch vor Ende des Gesetzgebungsverfahrens beginnt, sich mit dem bestehenden Personal die notwendige Expertise anzueignen. Der Referentenentwurf spricht zu Recht von der Knappheit kompetenter Fachkräfte, die weiterhin dringend auch auf dem privaten Arbeitsmarkt gebraucht werden.
Beratung vor Strafe muss Maxime bei Sanktionen werden
Für die nach Art. 99 KI-VO vorausgesetzten Sanktionen soll das Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) angewendet werden. Das ist konsequent und beseitigt Rechtsunsicherheiten. Die KI-VO selbst sieht die Möglichkeit von Verwarnungen und nichtmonetären Maßnahmen vor. Mit dem Verweis auf das OWiG wurde diese Möglichkeit offengehalten. Das war nicht nur richtig, sondern auch notwendig. Die Anforderungen der KI-VO sind neu und komplex. Ziel muss es sein, Unternehmen bei der Einhaltung der Regelungen zu unterstützen, statt sie für unbeabsichtigte Verstöße zu bestrafen. Gerade bei erstmaligen Verstößen oder bei neuen Sachverhalten muss die Verwarnung ohne Verwarnungsgeld die Regel werden. Jede Sanktion sollte eine Beratung voraussetzen, damit Unternehmen aus Fehlern lernen können und nicht durch hohe Bußgeldandrohungen vom Einsatz von KI-Tools abgeschreckt werden.
Richtig ist auch, dass der Appellcharakter der Regelung des Art. 4 KI-VO erkannt wurde und diese Anforderung sanktionsfrei bleiben soll. Es liegt im ureigenen Interesse der Unternehmen, Maßnahmen zu ergreifen, um die KI-Kompetenzen ihrer Beschäftigten zu fördern, damit die eingesetzten KI-Tools auch effizient genutzt werden. Eine Sanktionsandrohung ist daher nicht notwendig. Welche Maßnahmen erforderlich sind, hängt zudem sehr stark von den genutzten KI-Anwendungen und den betroffenen Beschäftigten ab. Eine Behörde wird kaum einschätzen können, welche Maßnahmen ein Unternehmen „nach besten Kräften“ ergreifen muss und was das „ausreichende Maß an KI-Kompetenz“ der Beschäftigten ist. Für die Betriebe wäre es unmöglich, sicher zu wissen, wann eine Sanktion droht. Regulierung und die Sorge vor Strafe hemmen schon jetzt den Einsatz von KI in den Betrieben in Deutschland. Weitere Rechtsunsicherheiten würden diesen Effekt noch verstärken.
Die vollständige Stellungnahme steht Ihnen in der rechten Marginalie zum Download zur Verfügung.
Ansprechpartnerin:
BDA | DIE ARBEITGEBER
Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände
Abteilung Strategie und Zukunft der Arbeit
T +49 30 2033-1070
Strategie@arbeitgeber.de
Die BDA organisiert als Spitzenverband die sozial- und wirtschaftspolitischen Interessen der gesamten deutschen Wirtschaft. Wir bündeln die Interessen von einer Million Betrieben mit rund 30,5 Millionen Beschäftigten. Diese Betriebe sind der BDA durch freiwillige Mitgliedschaft in Arbeitgeberverbänden verbunden.
![]()