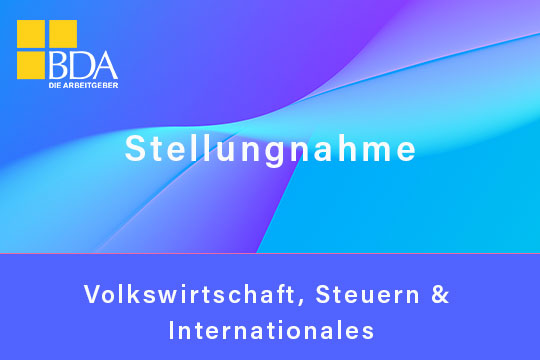Gleichmäßige Einkommensverteilung und steigende Vermögenszuwächse in Deutschland
Stellungnahme zum Entwurf des Siebten Armuts- und Reichtumsberichts der Bundesregierung
14. Oktober 2025
Zusammenfassung
Der Entwurf des Siebten Armuts- und Reichtumsberichts (ARB) der Bundesregierung bietet eine breite Datenbasis und greift zahlreiche gesellschaftliche Entwicklungen auf, bleibt jedoch in zentralen Punkten unausgewogen: Aus Sicht der Arbeitgeber fehlt es dem Bericht an einer klaren wirtschaftspolitischen Orientierung, die Einkommen und Vermögen auch in Zukunft sichert. Wachstum und eine starke Wirtschaft sind deren Grundlage. Eine praxisnahe und wirtschaftspolitische Bewertung der sozialen Lage in Deutschland fehlt. Eine stärkere politische Ausrichtung auf Standortstärkung, Eigenverantwortung und Sozialpartnerschaft ist dringend erforderlich, um die wirtschaftliche Zukunftsfähigkeit und sozialen Zusammenhalt voranzubringen.
Es gibt zwei Haupterkenntnisse des Berichts, die positiv hervorzuheben sind: Zwischen 2010 und 2021 blieb die Einkommensverteilung in Deutschland relativ stabil, trotz moderater Zunahme des Gini-Koeffizienten. Gleichzeitig stiegen die Vermögen, insbesondere bei Haushalten mit geringem Vermögen, und die Vermögensungleichheit nahm leicht ab.
Diese Entwicklung zeigt, dass insbesondere Arbeitsplätze und Tarifpartnerschaft wesentlich zur sozialen Stabilität beitragen: Durch faire Lohnabschlüsse und gemeinsame Verantwortung für Beschäftigung und Qualifizierung wird wirtschaftliche Teilhabe gefördert.
Die deutsche Wirtschaft befindet sich seit 2023 in einer Rezession. Strukturreformen, insbesondere in den Sozialsystemen, werden nicht konsequent genug verfolgt. Sozialleistungen bieten Fehlanreize, sind zu komplex, wenig treffsicher und nicht ausreichend aufeinander abgestimmt.
Der Bericht erkennt zwar Reformbedarf, bleibt aber vage in der Ausgestaltung der Lösungen. Eine umfassende Reform muss die Wirksamkeit aktiver Leistungen stärker in den Fokus rücken und die Eigenverantwortung der Menschen fördern. Arbeit muss sich wieder lohnen – wer arbeitet, muss spürbar bessergestellt sein als jemand, der nicht arbeitet.
Das bestehende System steuerfinanzierter Sozialleistungen ist zu komplex und ineffizient, weshalb eine umfassende Reform notwendig ist, die sowohl Geld- als auch aktive Leistungen berücksichtigt und den Sozialstaat treffsicherer, fairer und arbeitsmarktorientierter gestaltet. Die Grundsicherung für Arbeitsuchende sollte neu ausgerichtet werden, damit Arbeit sich lohnt und Jobcenter bessere Rahmenbedingungen für Vermittlung und Beratung erhalten. Förderinstrumente müssen gezielter auf den ersten Arbeitsmarkt ausgerichtet und Weiterbildung bedarfsorientiert sowie praxisnah gestaltet werden, um tatsächliche Perspektiven zu eröffnen und Komplexität zu vermeiden.
Auch die Rolle der Sozialpartnerschaft bei der Bewältigung des Inflationsanstiegs wird im Bericht nicht ausreichend gewürdigt. Arbeitgeber haben durch die Auszahlung der Energiepreispauschale und die Umsetzung der Inflationsausgleichsprämie maßgeblich zur Stabilisierung beigetragen – trotz hoher Belastung und fehlender direkter staatlicher Auszahlungsmechanismen.
Altersarmut ist in Deutschland weiterhin die Ausnahme – der Bericht sollte sich stärker auf die Ursachen im Erwerbsleben konzentrieren, etwa Arbeitslosigkeit und fehlende Altersvorsorge bei Selbstständigen. Die Darstellung der Grundrente als wirksames Instrument gegen Altersarmut ist nicht haltbar: Sie verfehlt ihr Ziel, da sie nicht die tatsächlich von Altersarmut betroffenen Gruppen erreicht und durch die ungleiche Bewertung gleicher Beitragsleistungen dem Prinzip der Leistungsgerechtigkeit widerspricht.
Der Bericht zeigt, dass Bildungserfolg und Chancengerechtigkeit stark vom sozioökonomischen Hintergrund abhängen und insbesondere Kinder aus armutsgefährdeten Haushalten sowie mit Migrationshintergrund schlechtere Zugänge zu früher Bildung haben. Um dem bildungspolitisch entgegenzuwirken, sind gezielte Sprachförderung, bessere Datenflüsse beim Übergang Schule-Beruf und praxisnahe Berufsorientierung notwendig, wobei auch die Weiterbildung Geringqualifizierter durch zielgerichtete Unterstützung gestärkt werden muss.
In der Gesundheitspolitik unterschätzt der Bericht die Bedeutung von Arbeit als Schutzfaktor. Erwerbstätigkeit stärkt Motivation, Selbstwertgefühl und psychische Stabilität – dieser Zusammenhang muss stärker berücksichtigt werden. Die pauschale Verbindung von Arbeitsverhältnissen mit psychischen Erkrankungen ist wissenschaftlich nicht haltbar und verkennt die komplexen Ursachen solcher Erkrankungen.
Der Bericht betont, dass strukturelle Reformen im Gesundheitswesen notwendig sind, um die Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) langfristig zu sichern – insbesondere durch Konzentration auf bedarfsnotwendige Krankenhäuser, Effizienzsteigerung, Stärkung der Eigenverantwortung der Versicherten und ordnungspolitisch korrekte Finanzierung versicherungsfremder Leistungen. Die Pflegeversicherung bleibt finanziell angespannt, wobei pandemiebedingte Zusatzkosten bislang nicht vollständig ausgeglichen wurden. Der Zukunftspakt Pflege wird zwar positiv bewertet, doch sind rasche und tiefgreifende Strukturreformen erforderlich, um eine nachhaltige Finanzierung sicherzustellen.
Die vollständige Stellungnahme steht Ihnen in der rechten Marginalie zum Download zur Verfügung.
Ansprechpartnerin:
BDA | DIE ARBEITGEBER
Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände
Abteilung EU, Internationales, Wirtschaft
T +49 30 2033-1050
eu@arbeitgeber.de
Die BDA organisiert als Spitzenverband die sozial- und wirtschaftspolitischen Interessen der gesamten deutschen Wirtschaft. Wir bündeln die Interessen von einer Million Betrieben mit rund 30,5 Millionen Beschäftigten. Diese Betriebe sind der BDA durch freiwillige Mitgliedschaft in Arbeitgeberverbänden verbunden.
![]()