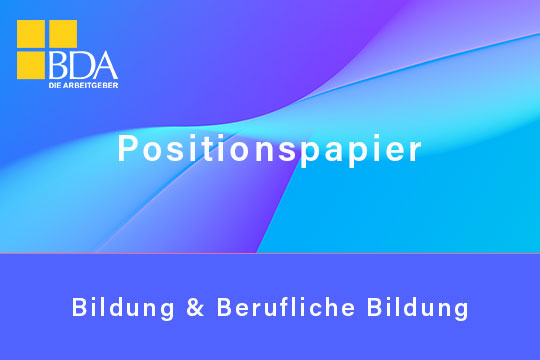Berufsschulen zukunftsfähig machen
Positionspapier - Chancen der Digitalisierung nutzen, Lernerfolg sichern, mit Partnern kooperieren
12. Dezember 2024
Zusammenfassung
Die Berufsschulen und ihre Lehrkräfte sind tragende Säulen der dualen Ausbildung und gleichwertige Partner der Ausbildungsbetriebe. Ihrer Arbeit gebühren hohe Wertschätzung und mehr öffentliche Wahrnehmung. Die enge und verbindliche Zusammenarbeit von Berufsschulen und Betrieben ist Kern der dualen Ausbildung. Beide Partner sollten noch aktiver aufeinander zugehen und sich gegenseitig Angebote zur Kommunikation und Zusammenarbeit machen. Betriebspraktika für Lehrkräfte sind dafür eine hervorragende Möglichkeit.
Berufsschulen stehen vor vielfältigen Herausforderungen. Die Länder müssen Lehrkräfte gewinnen, halten und passgenau qualifizieren, um Unterrichtsausfall zu vermeiden. Nur so kann der Lernerfolg einer zunehmend heterogenen Schülerschaft sichergestellt werden. Die Vorteile digitalen Lernens müssen konsequent genutzt und – in Ergänzung des Präsenzunterrichts – differenziert auf Lernende und Berufe zugeschnitten werden. Dies ist auch notwendig, um die Schülerinnen und Schüler auf die Arbeitswelt von morgen vorzubereiten. Berufsschulische Angebote müssen trotz rückläufiger Schülerzahl auch in ländlichen Regionen aufrechterhalten werden. Voraussetzung ist, dass die Berufsschulen über eine angemessene IT-Ausstattung verfügen. Ebenso brauchen sie den notwendigen technischen Support und Lehrkräfte, die im Umgang mit digitalen Medien gut ausgebildet sind.
Berufsschulen benötigen mehr Selbständigkeit, auch in Finanz- und Personalfragen. Das ist wichtig, um auf das unterschiedliche Leistungsprofil ihrer Lernenden eingehen zu können. Es müssen überfachliche Regelstandards eingeführt werden, damit alle Schulen in ihrer Vielfalt zu einer einheitlichen und verlässlichen Qualität gelangen.
Im Einzelnen
1. Virtuellen Unterricht an Berufsschulen ermöglichen
Digitales Lernen bietet zahlreiche Vorteile, wenn es pädagogisch, didaktisch und technisch gut umgesetzt wird. Virtuelle Unterrichtsformate bereiten Schülerinnen und Schüler auf die digitale Arbeitswelt von morgen vor. Sie machen es möglich, Fachklassen angesichts tendenziell sinkender Schülerzahlen und weiter Wege zur nächsten Berufsschule aufrecht zu erhalten, z.B. in ländlichen und strukturschwachen Regionen. Auch die Ausbildung von seltenen Berufen in sog. Bundesfachklassen kann erleichtert werden, indem aufwendige und teure Fahrten und Unterbringung während des Blockunterrichts reduziert und durch virtuelle Lernangebote ergänzt werden. Diese Vorteile müssen konsequent für die Berufsschule genutzt und sinnvoll mit analogem Lernen kombiniert werden. Präsenzunterricht hat dennoch weiterhin Vorrang. Digitales Lernen erfordert es, dass die Auszubildenden den Lernprozess erfolgreich selbst organisieren. Dass kann nicht bei allen Auszubildenden vorausgesetzt werden. Gerade zu Beginn einer Ausbildung ist dies nicht selbstverständlich.
Für manche Berufe und Branchen bietet sich digitales Lernen eher an als für andere. Dies gilt auch für die Lernenden, die bezogen auf individuellen Lernstand und Lernvoraussetzungen verschieden sind. Berufsschulen müssen digitales Lernen differenziert anbieten und Lerninhalte didaktisch anpassen. Wenn Berufsschulen virtuellen Unterricht anbieten, müssen sie sicherstellen, dass Auszubildende ohne Endgerät oder Internetzugang Möglichkeiten vor Ort erhalten.
Digitales Lernen eröffnet zahlreiche Möglichkeiten, die individuellen Bedürfnisse der Lernenden passgenau zu berücksichtigen und dadurch den Lernerfolg zu verbessern. So können Auszubildende z. B. auch außerhalb der üblichen Berufsschulzeiten oder im Tandem mit anderen Lernenden gute Fortschritte machen. Wenn im Ausbildungsbetrieb die notwendigen Ressourcen vorhanden sind, können die Auszubildenden auch mit der dortigen IT-Ausstattung lernen und von ihren Ausbildern unterstützt werden. Dazu sollten kreative Lern-Chancen im Austausch von Berufsschule, Ausbildungsbetrieb und Auszubildenden entwickelt werden. Dies schließt hybride Lernformen ausdrücklich mit ein. Auch virtuelles Prüfen kann zahlreiche Vorteile bieten und z.B. zeitnah Prüfungstermine mit mehreren Personen möglich machen. Gesetzlich ist es jetzt möglich, Prüferinnen und Prüfer zuzuschalten.
Jedes Bundesland muss prüfen, wie Anteile virtuellen Lernens im Unterricht an Berufsschulen rechtlich fest verankert und umgesetzt werden können. Die Kultusministerkonferenz (KMK) sollte begleitend eine bundesweite digitale Lernplattform voranbringen. Dabei müssen datenschutzrechtliche Standards gewährleistet sein. Die Lehrkräfte müssen dabei unterstützt werden, adressatenbezogene und flexibel einsetzbare Unterrichtsmaterialien zu entwickeln. Trotz virtueller Lernmöglichkeiten bleibt es unverzichtbar, die Berufsschulen mit einer ausreichenden Zahl an Lehrkräften auszustatten, die das Lernen begleiten.
2. Lehrkräfte gewinnen, halten und qualifizieren
Nach wie vor fehlen in vielen Regionen den Berufsschulen qualifizierte Lehrkräfte, insbesondere in den MINT-Fächern. Dies zeigen aktuelle Berechnungen wie z.B. die statistischen Veröffentlichungen der KMK.[1] Häufiger Unterrichtsausfall ist für den Ausbildungserfolg der Unternehmen und ihrer Auszubildenden von großem Nachteil und muss vermieden werden.
Berufsschullehrerinnen und -lehrer sind auch für Betriebe begehrte Fachkräfte, insbesondere im MINT-Bereich. Der Lehrernachwuchs sollte nach Studium und Referendariat auch tatsächlich an den Berufsschulen zum Einsatz kommen. Die KMK muss eine Gesamtstrategie vorlegen, um die heutige Unterversorgung zu beheben. Sie muss auch einen Prozess für eine geeignete Datengrundlage anstoßen. Die Länder müssen sich auf gemeinsame Qualitätsstandards für Daten einigen, die für Prognosen genutzt werden. Nur so können sie frühzeitig und länderübergreifend für eine ausreichende Zahl qualifizierter Lehrkräfte sorgen. Dies gilt z.B. für Daten zum Übergang vom Vorbereitungs- in den Schuldienst.
Um den Bedarf zu decken, müssen innovative Konzepte wie z.B. ein duales Lehramtsstudium durch die Länder geprüft, entwickelt und erprobt werden. Die Länder sollten Rekrutierungsinitiativen in Betracht ziehen und umsetzen. Sie sollten es ebenfalls ermöglichen, dass bei Bedarf auch die Ein-Fach-Lehrkraft und der Wechsel zum Master of Education nach einem anderen Bachelor möglich ist. Sie sollten kooperative Ausbildungsmodelle zwischen Universitäten und Fachhochschulen prüfen sowie bei Bedarf initiieren und fördern. So können Studierende eine berufliche Fachrichtung (FH) mit einem allgemeinbildenden Fach (Uni) flexibel kombinieren. Fachhochschulen und Universitäten sollten sich bei der Lehrkräfteausbildung eng vernetzen und dafür sorgen, dass der Wechsel zwischen beiden Institutionen einfacher wird.
Insbesondere Quereinsteiger, wie z. B. Ausbilder, Meisterinnen und Fachwirte, können aufgrund ihrer Praxiserfahrung aus der Berufswelt Berufsschulen bereichern. Dies sorgt auch für eine intensive Vernetzung mit der Fachpraxis. Quereinsteiger brauchen bei einem Wechsel in den Schuldienst didaktische Schulungen. Die Länder müssen prüfen, ob ausreichend berufsbegleitende Masterstudiengänge mit digitalen Lernkonzepten zur Verfügung stehen und sie ggf. bereitstellen. Quereinsteiger können auch über alternative Wege für die Berufsschule gewonnen werden z. B. mit Bachelor-Abschluss oder modularen Qualifizierungsbausteinen während der ersten Berufsjahre. Zudem sollten Schulleitungen die Möglichkeit erhalten, Personen nicht nur als reguläre Lehrkräfte, sondern auch als Dozentinnen bzw. Dozenten mit begrenzter Dauer beschäftigen zu können. So kann z. B. eine Meisterin eine länger erkrankte Lehrkraft vertreten. Unabhängig von ihrer Ausbildung benötigen alle Lehrkräfte eine effektive Fortbildung, die ihre professionelle Entwicklung fortlaufend unterstützt. Dies ist auch ein Zeichen der Wertschätzung und damit ein wesentlicher Faktor, um Lehrkräfte langfristig zu halten.
3. Enge Kooperation mit Betrieben pflegen, innovative Unterrichtsmethoden durchführen
Berufsschulen und Betriebe sind in der dualen Ausbildung Partner auf Augenhöhe. Sie müssen eng und verbindlich zusammenarbeiten. Dies ist auch im Berufsbildungsgesetz (BBiG §2 Abs. 2) rechtlich verankert. Die Berufsschulen können dadurch technische und wirtschaftliche Trends aktiv aufgreifen und Innovationen in die berufliche Bildung integrieren. Eine enge inhaltliche und organisatorische Kooperation (z. B. Zeitmanagement bei Blockunterricht) ist unabdingbar, damit
praktisches und theoretisches Lernen passgenau ineinandergreifen. Nur so können sich Lehrkräfte mit den Ausbilderinnen und Ausbildern im Betrieb zum individuellen Lernerfolg der jungen Menschen austauschen. Dazu eignen sich insbesondere auch digitale und kollaborative Lernplattformen, die von Berufsschule und Betrieb gemeinsam genutzt werden können. Eine
enge, persönliche Zusammenarbeit zwischen Berufsschullehrkräften und Ausbilderinnen und Ausbildern im Betrieb bleibt jedoch unerlässlich.
Betriebspraktika für Lehrkräfte sind eine hervorragende Möglichkeit zur engen Zusammenarbeit beider Partner. Lehrerinnen und Lehrer können dadurch vertiefte Einblicke in den unternehmerischen Alltag gewinnen und die Erfahrung für ihren Unterricht und die Vermittlung fachpraktischer Lerninhalte nutzen. Fachpraktische Lerninhalte dürfen nicht allein durch die Betriebe vermittelt werden, sondern müssen wichtiger Teil des berufsschulischen Lernens bleiben. Wichtiger Teil des betrieblichen Alltags ist es auch, handlungsorientiert und interdisziplinär an Projekte heranzugehen. Diese Kompetenz sollte in berufsschulische Curricula integriert werden, ebenso wie Demokratiebildung und das Vermitteln von Zukunftskompetenzen. Berufsschulen müssen nicht nur theoretisch und praktisch Wissen vermitteln. Sie begleiten auch
die Persönlichkeitsentwicklung der Auszubildenden und bieten ihnen einen geschützten didaktischen Rahmen, um das Gelernte zu vertiefen.
Berufsschulen sollten eng mit der Bundesagentur für Arbeit (BA) zusammenarbeiten, um gemeinsam möglichen Unterstützungsbedarf der Auszubildenden zu identifizieren und die passenden Förderinstrumente zu nutzen. Sie sollten sich neben den Betrieben auch mit anderen regionalen Berufsbildungsakteuren wie den allgemeinbildenden Schulen, überbetrieblichen Berufsbildungsstätten (ÜBS), Jugendberufsagenturen, Kammern und wirtschaftsnahen Bildungsträgern eng vernetzen. So können die Akteure vor Ort gemeinsam Aus- und Weiterbildungsstrategien entwickeln, die sich am jeweiligen Bedarf orientieren. Das Vernetzen ermöglicht den Berufsschülerinnen und -schülern zudem Einblicke in Wirtschaftsbereiche und Tätigkeitsfelder auch jenseits der jeweiligen Ausbildung.
4. Mehr Selbstständigkeit wagen - auch in Finanz- und Personalfragen
Berufsschulen müssen selbstständiger handeln können, auch in Personal- und Finanzfragen. Sie brauchen Spielraum, um auf das unterschiedliche Leistungsprofil ihrer Schülerinnen und Schüler eingehen und diese im engen Austausch mit den Betrieben individuell fördern zu können. Dazu gehört auch – sofern erforderlich – eine gezielte Sprachförderung z. B. bei Auszubildenden mit Migrations- oder Fluchthintergrund.
Die Schulleitung ist zentraler Motor der Unterrichts- und Qualitätsentwicklung. Bei dieser Aufgabe braucht sie eine gute Qualifizierung, kontinuierliche Beratung und spürbare Entlastung vom gestiegenen Verwaltungsaufwand. An großen Berufsschulen ist es sinnvoll, geeignete Führungsstrukturen einzurichten und eine mittlere Führungsebene mit Fach- und Personalverantwortung zu implementieren.
5. Einheitliche Berufsschulqualität sicherstellen, individuelle Bedarfe der Berufsschulen berücksichtigen
Rückmeldungen aus der Praxis zeigen, dass die Qualität an Berufsschulen sehr unterschiedlich ist. Für junge Menschen und ausbildende Unternehmen ist ein bundesweit vergleichbarer Lernerfolg zentral. Die Rahmenlehrpläne müssen durch gemeinsam festgelegte überfachliche Kernkompetenzen ergänzt werden, die als Regelstandards verbindlich sind. Hierzu gehören auch pädagogische Regelstandards für digital gestützten Unterricht.
Darüber hinaus sollten Berufsschulen regelmäßig Lernstandsdiagnostik einsetzen und den Ergebnissen entsprechende passgenaue Fördermaßnahmen ergreifen und nachhalten. Feedback von Schülerinnen und Schülern, Lehrkräften, Unternehmen und anderen Stakeholdern sollte aktiv eingeholt und genutzt werden, um kontinuierlich besser zu werden.
Eine angemessene Ausstattung ist Voraussetzung für qualitativ hochwertigen Unterricht. Berufsschulen sollten ihre Erfolgsgeschichten und die ihrer Lernenden sichtbar machen und sich untereinander vernetzen. So können sie Beispiele guter Praxis austauschen und voneinander lernen.
Die Bedarfe jeder einzelnen Berufsschule sind unterschiedlich: Die Vielfalt bei der Zusammensetzung der Lernenden, der Ausstattung, dem Lehrpersonal und anderen zentralen Arbeitsbedingungen ist groß. Berufsschulen müssen schnell und unbürokratisch die Ressourcen bekommen, die sie für ihre Arbeit benötigen. Das gilt nicht nur für Personalfragen, sondern auch für die sächliche Ausstattung.
6. Digitalisierung vorantreiben, Ausstattung auf einen guten Stand bringen
Begleitender technischer Support ist für jede Berufsschule unabdingbar. Damit sich die Lehrkräfte auf ihre Kernaufgaben konzentrieren können, müssen andere fachkundige Personen Aufgaben wie z.B. die regelmäßige Wartung von Hard- und Software übernehmen. Unabdingbar ist ebenfalls ein ausreichender Fortbildungsetat, einfacher Zugang zu digitalen Medien für Lehrende und Lernende, Regelungen zu Datenschutz und Urheberrecht sowie entsprechende Unterrichtsmaterialien. Angesichts der großen Unterschiede bei der digitalen Ausstattung von berufsbildenden Schulen sollten länderübergreifende Mindeststandards festgelegt werden. Die Länder sollten anschließend eine darüber hinaus gehende Ausstattung prüfen und bei Bedarf vornehmen. Der „DigitalPakt 2.0“ muss jetzt umgesetzt und mit ausreichend finanziellen Mitteln für die Berufsschulen ausgestattet werden.
7. Heterogene Schülerschaft berücksichtigen, Lernerfolg sicherstellen
8. Beschulung im ländlichen Raum sichern, Mobilität fördern, Wohnheime angemessen ausstatten
Auch dezentrale Lernorte können Vorteile für die Lernortkooperation im ländlichen Raum bieten. So könnten dafür z.B. die Räumlichkeiten der örtlichen Gemeinde oder anderer Institutionen genutzt werden und so Fahrtzeiten aller Beteiligten reduziert werden. Hier sind kreative Ideen gefragt.
Um angebotene Ausbildungsplätze zu besetzen und den Nachwuchsbedarf der Unternehmen zu sichern, muss die regionale Mobilität von Auszubildenden gefördert werden. Das trifft auch für seltene Ausbildungsberufe zu, die in Landes- oder Bundesfachklassen beschult werden. Vorhandene Förderinstrumente müssen konsequent genutzt werden. So können z. B. mit der Berufsausbildungsbeihilfe (BAB) Fahrt- und Unterbringungskosten erstattet werden.
9. Möglichkeiten bei der Berufsschulwahl kommunizieren und nutzen
10. Fokus der Berufsschule auf Ausbildung beibehalten – Pakt für berufliche Schulen mit finanziellen Mitteln ausstatten
[1] STATISTISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN DER KULTUSMINISTERKONFERENZ
Dokumentation Nr. 238 – Dezember 2023; Quelle: Tabelle 4 (KMK-Vorausberechnung des Einstellungsbedarfs 2020- 2030), KMK (2020a), S. 17 - 26, Tabelle 6 (Lehrkräftebedarf, Lehrerkräftebestand und Einstellungsbedarf bis 2030)
Ansprechpartnerin:
BDA | DIE ARBEITGEBER
Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände
Abteilung Bildung
T +49 30 2033-1500
bildung@arbeitgeber.de
Die BDA organisiert als Spitzenverband die sozial- und wirtschaftspolitischen Interessen der gesamten deutschen Wirtschaft. Wir bündeln die Interessen von einer Million Betrieben mit rund 30,5 Millionen Beschäftigten. Diese Betriebe sind der BDA durch freiwillige Mitgliedschaft in Arbeitgeberverbänden verbunden.
![]()